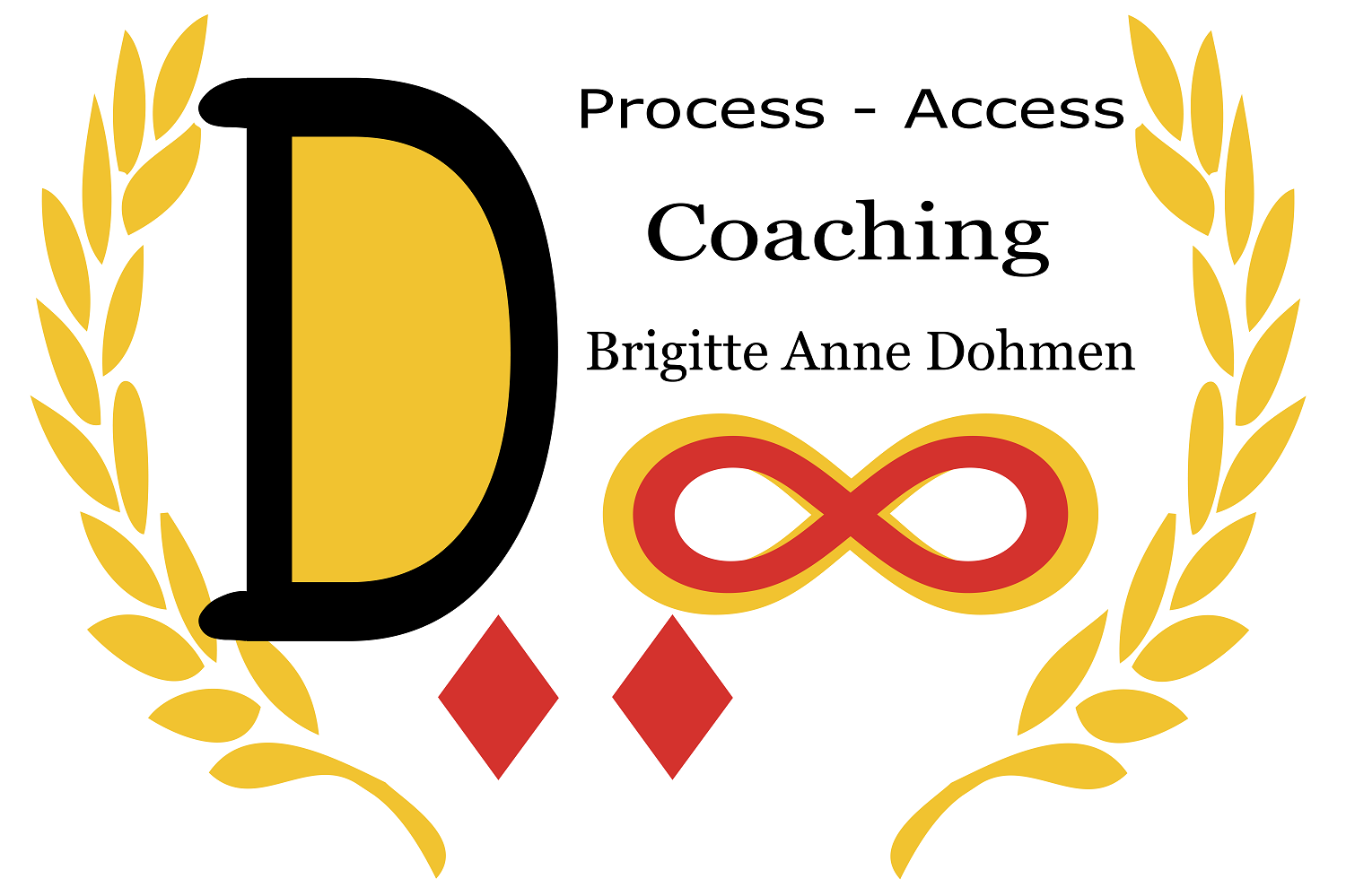Transkriptom-Sequenzierungstechnologien öffnen die Türen zu einer neuen Ära der zellulären Entdeckung, und nicht nur im Gehirn.
Es war Mehres ist mehr als ein Jahrhundert her, dass der spanische Neuroananatoge Santiago Ramón y Cajal für die Veranschaulichung der Art und Weise erhalten hat Neuronen es Ihnen ermöglichen, zu gehen, zu sprechen, zu denken und zu sein. In den dazwischenliegenden hundert Jahren hat die moderne Neurowissenschaft so viel Fortschritte gemacht, wenn es darum geht, wie sie eine Art von Neuron von einer anderen unterscheidet. Sicher,aber Gehirnzellen werden immer noch in erster Linie durch zwei arbeitsintensive Eigenschaften definiert: wie sie aussehen und wie sie sich verknüpfen vermehren und feuern. Aus diesem Grund beeilen sich Neurowissenschaftler auf der ganzen Welt, neue, differenziertere Methoden zur Charakterisierung von Neuronen zu übernehmen. Sequenzierungstechnologien zum einen können zeigen, wie Zellen mit genau derselben DNA ihre Gene auf einzigartige Weise ein- oder ausschalten – und diese Methoden beginnen zu zeigen, dass das Gehirn ein vielfältigerer Wald von Borstenknoten und verzweigten Energien ist. Eine der zentralen Fragen der Hirnforschung lautet: Was genau passiert im Gehirn, wenn wir lernen? Im Detail kann das bis heute niemand beantworten, aber seit mehr als einhundert Jahren steht eine winzige Struktur im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: die Synapse – der Ort, wo zwei Nervenzellen aufeinander treffen. Allerdings berühren sich die beiden Zellen dort gar nicht. Das entdeckte schon der berühmte Neuroananatoge Santiago Ramon y Cajal am Ende des 19. Jahrhunderts, als er angefärbte Hirnschnitte unter dem Mikroskop untersuchte. Stattdessen sind die beiden Zellen durch einen winzigen Spalt von etwa 20 Nanometern getrennt, der somit 5000 Mal dünner als ein menschliches Haar ist. Das sendende Neuron auf der einen Seite wird als präsynaptisch, das empfangende auf der anderen Seite als postsynaptisch bezeichnet. Eine elektrische Erregung läuft das Axon– das „Kabel“ – des präsynaptischen Neurons entlang, bis sie den Spalt erreicht. Dort werden daraufhin zahlreiche Bläschen mit Botenstoffen in den synaptischen Spalt entleert. Je nach Synapse kann es sich dabei um Dopamin, Adrenalin, Acetylcholin, Glutamat oder eine andere Substanz handeln. Die Botenstoffe docken auf der anderen Seite des Spalts an Rezeptoren auf der Oberfläche der postsynaptischen Zelle an. Daraufhin öffnet sich beim „Empfänger“ ein Kanal und Calciumionen (Ca2+) strömen ins Innere der Zelle. War die „Botschaft“ des Senders intensiv genug, gelangt also genügend Ca2+ ins Innere des Empfängers, dann wird dessen elektrisches Gleichgewicht gestört und damit ein Potenzial ausgelöst – die Botschaft reist auf diese Weise weiter zur nächsten Station. „Lernen bedeutet im Grunde genommen, diesen Prozess so zu verändern, dass es leichter oder schwieriger wird, die Nervenzelle auf der anderen Seite des Spalts zu erregen“, sagt Dominique de Quervain , der an der Universität Basel die molekularen Grundlagen des Gedächtnisses erforscht. Wissenschaftler nennen das Phänomen synaptische Plastizität. Es ist die Grundlage für ständige Veränderungen im Gehirn und erlaubt dem Menschen bis ins hohe Alter, neue Dinge zu erlernen, neue Erfahrungen zu machen.
Lernen vom Nachbarn: die Langzeitpotenzierung
Aber wie verändern Erfahrungen die Synapse? 1973 entdeckten Thimothy Bliss und Terje Lømo einen Mechanismus. Die beiden Neurowissenschaftler untersuchten einzelne Synapsen. Sie stimulierten die präsynaptische Zelle mit einer winzigen Elektrode und maßen dann die Erregung der postsynaptischen Zelle. Ein schwacher Reiz führte dabei auch nur zu einer schwachen Reaktion des zweiten Neurons. Wurde das sendende Neuron aber stark stimuliert, führte das nicht nur zu einer starken Reaktion im empfangenden Neuron. Hinterher reagierte es auch viel stärker auf einen schwachen Reiz des ersten Neurons – und das auch noch Stunden später. Die synaptische Übertragung war durch die Aktivität offenbar effektiver geworden. Der Effekt wird als Langzeitpotenzierung bezeichnet, meist als LTP abgekürzt, vom englischen „long-term potentiation“. Er war das erste Beispiel dafür, dass Erfahrungen die Aktivität von Nervenzellen ändern können, und er schien direkt auf eine These zurückzuweisen, die der kanadische Psychobiologe Donald Hebb 1949 aufgestellt hatte. Wenn eine Nervenzelle A immer wieder eine Nervenzelle B aktiviere, glaubte Hebb, ändere sich die Verschaltung der beiden Zellen so, dass es für A immer leichter werde, B zu stimulieren. Stark vereinfacht kann man sich so auch die Entstehung bestimmter Assoziationen vorstellen. Nimmt man zum Beispiel die Farbe Rot immer wieder auf Warnschildern und als Stoppsignal an Ampeln wahr, dann kann man sich vorstellen, dass es dem „Rot“-Neuron immer leichter fällt, auch das „Stopp“-Neuron zu aktivieren, bis die beiden fast automatisch zusammen aktiv werden. Nur, dass es in Wirklichkeit nicht einzelne Nervenzellen sind, die solche Konzepte codieren, sondern vermutlich die Aktivitätsmuster ganzer Zellnetzwerke. Bekannt wurde das Prinzip als „Neurons that fire together, wire together“. Also: Zellen, die gleichzeitig aktiv sind, verschalten sich auch. Obwohl dieser Ausspruch immer wieder Donald Hebb zugeschrieben wird, taucht er offenbar erst 1992 in einem Fachartikel von Siegrid Löwel und Wolf Singer auf.
Ein eigenes Entsorgungssystem für das Gehirn
Wie aber schafft es das Gehirn seine Abfallprodukte aus dem Zellstoffwechsel ganz ohne Lymphe effizient loszuwerden? Das fragten sich Forschende in der Vergangenheit immer wieder – so auch die dänische Neurobiologin Maiken Nedergaard von der Universität Rochester in New York. Um dem Rätsel auf die Spur zu kommen, injizierte sie eine fluoreszierende Markierungssubstanz in das Nervenwasser von lebenden Mäusen. Mithilfe eines Multiphotonenmikroskops beobachtete sie, wie sich der Tracer im Liquor und im Gehirn bewegte. Sie staunte: Der Farbstoff im Nervenwasser stieg über den Rückenmarkskanal in Richtung des Hirnstamms auf und gelangte über den Flüssigkeitsraum zwischen Schädeldecke und Gehirn, den so genannten Subarachnoidalraum, ins Gehirn. Neben den Blutgefäßen erstreckt sich im Hirn ein verzweigtes, bis dahin unbekanntes Kanalsystem, das meist parallel zu den angrenzenden Blutbahnen verläuft. Später verschwand die fluoreszierende Substanz wieder über Kanäle, die entlang der Venen in Richtung Rumpf führten. Die Wasserkanäle flankieren die Blutgefäße und sind zum Hirngewebe hin mit Astrozyten bedeckt. Astrozyten sind sternförmig verzweigte Nervenzellen. Sie tragen im Gehirn an ihren Ausläufern sogenannte Endfüße und an diesen sitzen, wie Nedergaard bemerkte, zahlreiche wasserdurchlässige Poren. Diese bestehen aus dem Protein Aquaporin-4. Die Neurobiologin schloss aus ihren Befunden: Die Poren ermöglichen das Abzweigen von Nervenwasser aus dem Kanal, das dann in die Räume zwischen den Hirnzellen fließt und diese fortlaufend umspült. Dabei nimmt das Nervenwasser Abfallstoffe auf. Da das System dem Lymphsystem gleichkommt, taufte Nedergaard es in ihrer Veröffentlichung 2012 „glymphatisches System“. Sie spielte damit einerseits auf das bekannte Entsorgungssystem an, flocht andererseits den Begriff „Glia“ ein – denn zu diesem Zelltyp gehören die Astrozyten.
Nächtliche Gehirnwäsche
Kurz darauf beobachtete Nedergaard – ebenfalls an Mäusen, dass das glymphatische System vor allem in der Nacht aktiv ist. Sie sah zu, wie die Hirnzellen während des Schlafs schrumpften und somit der wasserdurchspülte Zellzwischenraum zunahm – gar um 60 Prozent. Tiefere Hirnregionen würden nur nachts gereinigt, postulierte die Neurobiologin daraufhin. Und als sie das Protein Beta-Amyloid – Bestandteil der Ablagerungen im Gehirn bei der Alzheimer‘schen Erkrankung – in das Nervenwasser der Mäuse zufügte, erreichte es nachts rascher das Hirngewebe. Sie rechnete im Fachblatt Science 2013 anlässlich ihrer Experimente aus, dass der Einstrom des Nervenwassers im Schlaf um 95 Prozent zunahm. Nedergaard schließt daraus, dass die „Gehirnwäsche“ nachts auf Hochtouren arbeitet. Damit wirft sie eine ganz neue mögliche Erklärung für neurodegenerative Erkrankungen wie Demenzen und die Parkinsonsche Erkrankung in den Raum: Vermutete man bislang, dass Beta-Amyloid und andere fehlgefaltete sowie hyperphosphorylierte Proteine im Gehirn selbst abgebaut würden, bringt Nedergaard nun deren Abtransport durch das glymphatishe System ins Spiel. Funktioniert etwa die Entsorgung der schädlichen Proteine bei neurodegenerativen Leiden nicht mehr richtig? Vermüllt das Gehirn und gehen die Nervenzellen dadurch unter? Die Hinweise darauf sind inzwischen mannigfaltig. Viele der Beobachtungen kommen von Experimenten an Mäusen: so etwa, dass sich schädliche Proteine wie Beta-Amyloide und Tau bei Demenzen und das für die Parkinson‘sche charakteristische alpha-Synuclein im Gehirn ansammeln, wenn das glymphatische System nicht richtig funktioniert. Das passiert beispielsweise, wenn die Aquporin-4-Kanäle über eine genetische Veränderung in Mäusen blockiert werden. Nedergaards Forschungen zufolge, bricht der Einstrom an Nervenwasser in das Gehirn um 70 Prozent ein. Tatsächlich sind bei vielen neurologischen Leiden, angefangen bei Demenzen über Migräne und Schädel-Hirntraumata, das glymphatische System und im Speziellen die Aquaporin-4-Kanäle verändert.
Dem Entsorgungssystem des Hirns bei der Arbeit zuschauen
„Die größte Einschränkung ist im Moment, dass wir das glymphatische System am Menschen nur indirekt beobachten können“, bedauert Katerina Deike-Höffmann Neuroradiologin an der Universitätsklinik Bonn. „Unser Goldstandard ist eine Methode, die so invasiv ist, dass sie bisher nur die Arbeitsgruppe um den Radiologen Geir Ringstad und den Neurochirurgen Per Eide am Universitätskrankenhaus in Oslo praktiziert.“ Sie spritzen Freiwilligen das gadoliniumhaltige MRT-Kontrastmittel Gadubutrol auf Höhe der Lendenwirbelsäule in den Liquor. Dabei handelt es sich um eine sogenannte off-Label-Anwendung: Die Arznei ist für diesen Einsatz nicht zugelassen. Zunächst wagten beide Forscher ihre Experimente daher nur an Gesunden und ergründeten, was guter Schlaf bewirkt. Sieben Teilnehmende ließen die Forscher nach der Markierung ihres Nervenwassers die Nacht über aufbleiben. Siebzehn andere gingen wie gewohnt zuhause zu Bett. Der aufsehenerregende Befund brachte beiden 2021 eine Publikation im Journal Brain ein: Das Kontrastmittel hing bei den Personen mit Schlafentzug im Gehirn fest, wohingegen es aus dem Kopf der übrigen Probanden rascher verschwand. Besonders im cerebralen Cortex, der Region für Denken, Planen und Handeln, aber auch im Gefühlszentrum, dem limbischen System, und der weißen Substanz (LINK) zeigte sich die unterschiedlich starke Ansammlung von Abfallprodukten im Gehirn in beiden Gruppen. Und obwohl alle Probanden anschließend eine Nacht mit normalem Schlaf bekamen, konnte das Entsorgungssystem bei den Übermüdeten den Rückstand nicht mehr aufholen. Die Experimente belegen das erste Mal am Menschen, dass die Reinigung des Gehirns im Schlaf geschieht, hält Eide fest. Und, dass verpasster Schlaf nicht nachgeholt werden kann. Dazu passend demonstrierte die Forschungsgruppe um die Neurobiologin Nora Volkow vom National Institute of Health in Bethesda schon 2018 an 20 gesunden Probanden, dass eine Nacht ohne Schlaf die Konzentration an beta-Amyloid in bestimmten Regionen ihres Gehirns erhöht. Betroffen war der rechte Hippocampus und der Thalamus, der eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung von Sinneseindrücken spielt. Der Nachweis von mehr Proteinmüll im Gehirn bei Schlafmangel passt gut zu verschiedenen Längsschnittstudien, die darlegen, dass jene Menschen, die schlecht schlafen, ein erhöhtes Risiko haben, nachfolgend an einer Demenz zu erkranken. Nachts herumzugeistern ist damit wahrscheinlich nicht nur eine Folge der Krankheit, sondern befeuert sie auch.