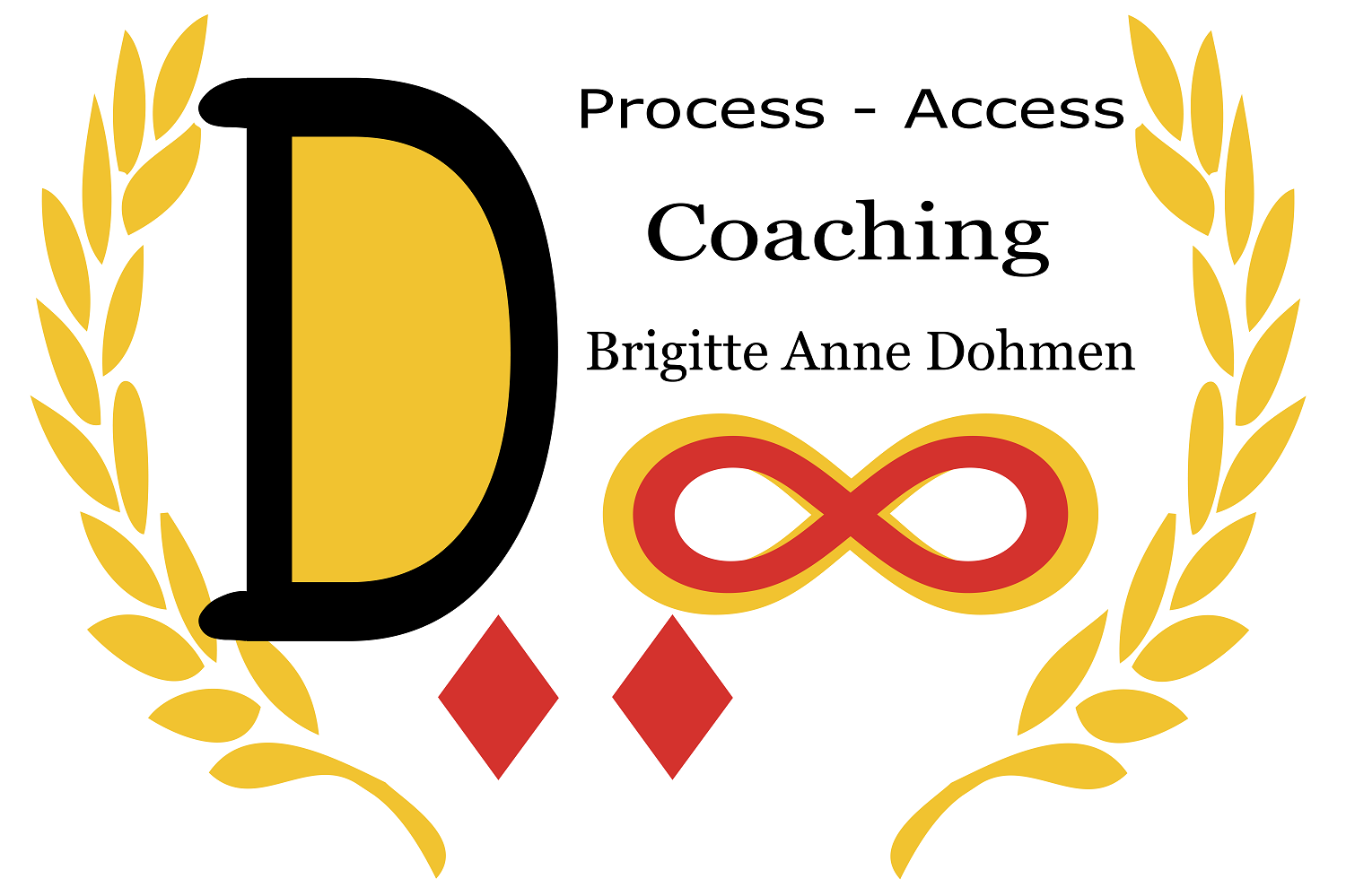Period Gen
Früher bestimmte die Natur mit ihrem täglichen Licht-Dunkel-Wechsel unseren Alltag. Der Mensch entwickelte einen typischen Biorhythmus mit täglichem Leistungshoch und nächtlichem Leistung und Entspannung
Die innere Uhr tickt bei jedem anders
Das Sonnenlicht ist unser wichtigster äußerer Taktgeber. Es eicht die inneren Uhren täglich neu auf einen 24-Stunden-Rhythmus mit Aktivitäts- und Ruhephasen. Doch seit Erfindung der Glühbirne macht der Mensch die Nacht zum Tag. Als Folge von Schlafmangel und Übermüdung häufen sich Fehlern, Unfälle und Krankheiten. Die innere Uhr des Körpers kann man nicht hören oder sehen aber sie tickt unablässig und hält sich nicht an die von unserer Gesellschaft vorgegebenen Zeiten. Der Körper besitzt viele Uhren Gene. Doch es gibt auch Fälle, in denen die inneren Uhren verstellt sind. Fallbeispiel : Betsy Thomas:“Period-Gen“ veränderte sich der Tagesrhythmus und dadurch geriet ihre innere Uhr durcheinander, die normalen Tagesrhythmen verschieben sich. Neben Betsy Thomas gibt es noch weitere Frühschläfer. Doch bei ihnen suchten die Forscher die Period-Gen-Veränderung vergeblich. Es muss also viele Uhren-Gene im Körper geben. Und alle sind wahrscheinlich kleine Rädchen, die das gesamte innere Uhrwerk verstellen können.
Sonnenlicht gibt den äußeren Takt vor
Der Biorhythmus ist fast so alt wie das Leben selbst. Sogar Einzeller besitzen Uhren-Gene, die ihren Tagesablauf regeln. Solche Gene kommen in allen Organismen vor und ähneln sich stark. Der innere Grundrhythmus lässt sich kaum verstellen. Das Sonnenlicht als wichtigster äußerer Taktgeber stellt den Grundrhythmus, der zwischen 23,5 und 25 Stunden schwankt, täglich neu auf 24 Stunden ein. Im Wechsel von Tag und Nacht steigt und sinkt die Körpertemperatur, verändern sich die Hormonspiegel im Blut, aber auch die Empfindlichkeit von Nerven. Schmerzen werden nachmittags zum Beispiel weniger stark empfunden als nachts. Sonnenlicht synchronisiert unsere inneren Uhren auch auf jahreszeitliche Rhythmen. Welche Auswirkungen die inneren Uhren haben können, verdeutlichen Beispiele aus dem Tierreich. Manche Tiere halten Winterschlaf, viele Fortpflanzungszeiten richten sich nach dem Rhythmus der Natur. Wie genau diese inneren Uhren aussehen, wie sie funktionieren, ob es eine Hauptuhr gibt, ist noch weitgehend unerforscht. Die Chronobiologie steht erst am Anfang, doch einige weitere Uhren-Gene hat man schon in den verschiedensten Organismen entdeckt. Sie tragen klangvolle Namen wie „timeless“, „clock“, „double-time“ oder „period“.
Wie wird der Biorhythmus gesteuert?
Vermutlich ist unser Biorhythmus ein Regelkreislauf. Die Tageszeit erkennt der Körper über die Lichtintensität der Sonnenstrahlen. Vor einigen Jahren wurde in der Netzhaut das Sehpigment Melanopsin entdeckt, das äußerst empfindlich auf Veränderungen der Lichtintensität reagiert. Die Information gelangt über die Sehnerven in einen entwicklungsgeschichtlich uralten Hirn-Nervenkern. Viele Forscher halten diesen Kern, den Nucleus suprachiasmaticus (SCN), für das Kernstück der Körperuhr. Hier wird der 24-Stunden-Rhythmus synchronisiert, die innere Uhr etwas nach vorn oder nach hinten verstellt. Gleichzeitig scheint hier aber auch der Grundrhythmus gesteuert zu werden. Die Nervenimpulse des SCN beeinflussen andere Hirnregionen, und über Gehirndrüsen, die tagesperiodisch Hormone ausschütten, auch die unterschiedlichsten Körperfunktionen. Die Nervenzelle des SCN könnten so etwas wie eine Schrittmacher-Funktion besitzen. Hier wurde auch ein „Period-Gen“ gefunden. Tieren, denen man den SCN entfernte, verloren ihren typischen Tagesrhythmus. Vom SCN werden vermutlich Schlaf- und Wachphasen gesteuert, aber auch die Körpertemperatur. Das Leben auf der Erde hat sich durch unsere Umweltreize entwickelt der rhythmische Wandel der Zeit. Die zeitliche Organisation im Verhalten Aktivität durch die Aufnahme von Nahrung unserem Schlaf und die Aktivität. In der Physiologie ist in allen Organismen gemeinsam und reflektiert die Rhythmik der zyklischen Rotationsbewegung von Sonne Mond und Erde. die zeitliche Koordination unterliegt der Steuerung durch ein endogenes Zeitprogramm und setzt einen vorhersagbaren und Rhythmus voraus. im morphologischen Korrelat des suprachimastischen Nucleus (SCN) des Hypothalamus. Diese paarig angelegte Neuronengruppe beim Menschen 20 000 dicht gepackten Nervenzellen im vorderen Hypothalamus reguliert als sogenannter zirkadianer Schrittmacher oder master – clock die gesamte innere Rhythmik des Organismus.
Auch Organe unterliegen Rhythmen
Auch die Zellen in den Körperorganen enthalten Uhren-Gene. Sie können über Nerven- oder Hormonsignale vom Gehirn aus aktiviert werden, aber auch ein Eigenleben entwickeln. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass die Leber als zentrales Stoffwechselorgan rhythmische Aktivitätsschwankungen entwickelt, wenn nur zu bestimmten Zeiten Nahrung verwertet werden kann. Ratten die ausschließlich zu ungewöhnlichen Zeiten gefüttert wurden, entwickelten eine neue Leber-Rhythmik. Das verdeutlicht, wie kompliziert das Wechselspiel des Uhren-Räderwerks ist. Der Zell-Chronograph funktioniert im Prinzip wie eine Wasseruhr. Die Zelle produziert laufend Proteine, zum Beispiel über Period-Gene, die von äußeren Einflüssen wie zum Beispiel dem Nahrungsangebot aktiviert werden können. Die Produktion läuft so lange, bis die Zelle gewissermaßen überläuft. Dann blockieren die Proteine in einer Art Rückkopplung ihre eigene Produktion, werden langsam wieder abgebaut – und alles beginnt von neuem. Andere Uhren-Gene regulieren die Geschwindigkeit eines solchen Zyklus, der dann insgesamt 24 Stunden dauert. Der zirkadiane Rhythmus ist die Fähigkeit eines Organismus, physiologische Vorgänge auf eine Periodenlänge von etwa 24 Stunden zu synchronisieren. Der wichtigste zirkadiane Rhythmus ist der Schlaf-Wach- Rhythmus Der zirkadiane Rhythmus ist weitgehend unabhängig von äußeren Faktoren, die auf die jeweilige Tages-, Nacht- oder sogar Jahreszeit hinweisen könnten. Er dient dazu, sich zur Zeit orientieren zu können und die periodisch durchgeführten Tätigkeiten, wie z.B. Schlafen, Nahrungsaufnahme, Winterschlaf, Fortpflanzung etc. in einem relativ konstant bleibenden Rhythmus durchzuführen. Durch die wechselnde Tageslänge in Folge des Jahreszeiten-Wechsels ist eine ständige Resynchronisation der Inneren Uhr notwendig. Der zirkadiane Rhythmus muss heutzutage jedoch häufig durch einen raschen Wechsel der geographischen Lage, wie z.B. nach einen Transatlantikflug, sehr kurzfristig resynchronisiert werden, die Folge einer anfänglich fehlenden Übereinstimmung ist der bekannte Jet Lag. Die Synchronisation und Anpassung geschieht durch spezielle Photprezeptoren in der äußeren Körnerschicht der Retina. Die so genannten photosensitiven Ganglinienzellen ,enthalten das Photopigment Melanosund liegen und liegen zwischen den beiden Schichten der Ganglien un Hinterneuronen Zellen. Sie projizieren über den Tractus retinohypothamicus zum Nucleus suprchiomaticus des Hypothalamus. Der Nucleus suprachiasmaticus ist die zentrale „Schaltstelle“ der zirkadianen Uhr und koordiniert weitere periodisch wechselnde Körperfunktionen:
- Körpertemperatur
- Hormonsekretion
- Blutdruckschwankungen
- Herzfrequenz
- Urinproduktion
Ron Konopka und Seymour Benzer vom California Institute of Technology fanden das period–Gen(per), dessen Fehlen bei der Fruchtfliege Drosophila zu einem vollkommenen Fehlen jeglicher Rhythmik geführt hat, eine Mutation erzeugte eine kürzer- oder längerperiodische Rhythmik als übliche 24 Stunden.
Bei den Säugetieren, v.a. bei der Maus fanden sich zahlreiche assoziierte Gene
- Cry (Cryptochrome)
- Clock (Circadian locomotor output cycles kaput)
- Bmal1(brain and muscle, ARNT-like)
- Per1 (Period 1)
- Per2 (Period 2)
- Per3(Period 3)
- Antiduretisches – Hormon- Effekthormon – Prepropressophysin (VP) (clock controlled genes; ccg)
Diese Gene steuern in komplexer Zusammenwirkung die Transkription u von autoregulatorischen Feedback–Schleifen, die recht genau 24 Stunden in Anspruch nehmen. BMAL 1 und PER 2 werden u.a. durch Licht und Temperatur gesteuert und wirken als positive Verstärker. Ihre Transkription setzt mit Tagesbeginn und Lichteinfall ein. BMAL1 und CLOCK binden als Dimer an die regulatorische DNA-Sequenz (E-Box) und veranlassen die Transkription von CRY, PER1, PER2, PER3. Sie werden daher als “ clock Controller generes (CCG) bezeichent. Die Transkripte verlassen nach bekanntem Mechanismus den Nucleus und werden im Zytoplasma modifiziert. Steigt die Konzentration von PER2 und CRY im Zytoplasma assoziieren diese zu einem Dimer und physikalischer Prozess zurück in den Nucleus. Hier steigert PER2 die Transkription von CLOCK und BMAL1 während CRY an das CLOCK-BMAL1–Tandem bindet, und diese an einer weiteren Stimulation der Transkription hindert
CRY1. Schlafphasensyndrom
Das verzögerte Schlafphasensyndrom (delayed sleep phase disorder, DSPD) ist eine häufige Schlafstörung, bei der die Schlafphasen gegenüber dem gewöhnlichen bzw. üblichen Rhythmus regelmäßig nach hinten verschoben sind. Die Betroffenen sind „Nachteulen“: Ihre innere Uhr tickt anders, d.h. sie können am Abend erst spät und nur schlecht einschlafen, es fällt ihnen schwer, zu den üblichen Zeiten am Morgen aufzustehen, und sie sind tagsüber müde. Wissenschaftler haben nun bei einer Betroffenen eine dominante Variante in cryptochrome circadian clock 1, dem CRY1-Gen, als genetische Ursache des DSPD ermittelt. CRY1 ist ein wesentliches Element des molekularen Uhrwerks, in dem verschiedene Gene agieren und über Rückkopplungsschleifen den endogenen zirkadianen Rhythmus in der Regel mit einer Periodenlänge von etwa 24 Stunden steuern. Wie die Forscher im Fachjournal Cell berichten, bewirkt die nun identifizierte Mutation in CRY1, dass ein hemmender Transkriptionsfaktor mit einer erhöhten Affinität zu den aktivierenden zirkadianen Proteinen Clock und Bmal1 entsteht. Die Steigerung der CRY1-Funktion führt zu einer geringeren Expression der Haupttranskriptionsziele und die Phasen der zirkadianen molekularen Rhythmen werden verlängert. Das veränderte CRY1-Allel ist in Genomdatenbanken mit einer Häufigkeit von bis zu 0,6 % verzeichnet. Die Wissenschaftler konnten bei der Untersuchung von weiteren Trägern der Variante in unterschiedlichen Familien feststellen, dass diese ebenfalls auffällige Schlafmuster aufwiesen, und kommen zu dem Schluss, dass diese genetische Variante bei einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung für Schlafstörungen ursächlich sein dürfte. Patke A, Murphy PJ, Onat OE, … Young MW. Mutation of the Human Circadian Clock Gene CRY1.
Das „Nachteulen“-Gen
Menschen mit einer verzögerten Schlafphasenstörung (Delayed Sleep Phase Disorder, DSPD) können in der Regel erst um 3 oder 4 Uhr morgens oder noch später einschlafen. Es fällt ihnen schwer, ihre Arbeit oder Schule zu den üblichen Zeiten zu beginnen. Da sie oft zu kurz schlafen, leiden sie häufig unter extremer Müdigkeit. Im Juni berichtete Dr. Alina Patke, wissenschaftliche Mitarbeiterin von Dr. Michael W. Young und anderen, in der Zeitschrift Cell, dass ihre Gruppe bei der familiären DSPD eine Mutation des menschlichen Gens für die zirkadiane Uhr CRY1 festgestellt hat. CRY1 wurde schnell als das „Nachteulen“-Gen betitelt. Durch die Mutation ist eines der Proteine von CRY1 überaktiv. Menschen mit dieser Mutation haben einen überdurchschnittlich langen zirkadianen Zyklus und einen deutlich verzögerten Schlaf. Die Forscher fanden die CRY1-Mutation bei einer 46-jährigen Frau, bei der aufgrund ihrer Schlafprotokolle und Laboruntersuchungen ihres Schlafs, ihrer Hormone, ihrer Körpertemperatur und anderer zirkadianer Rhythmen DSPD diagnostiziert worden war. Sie fanden dieselbe Mutation auch bei anderen Familienmitgliedern, die spät ins Bett gehen und die autosomal dominant vererbt wird. DSPD ist die am häufigsten diagnostizierte Schlafstörung mit zirkadianem Rhythmus. Etwa 0,1 Prozent der Bevölkerung weltweit tragen die CRY1-Mutation, sagte Young auf einer Pressekonferenz an der Rockefeller University am 2. Oktober auf die Frage eines Reporters nach möglichen praktischen Vorteilen seiner Forschung. „Wir haben jetzt Möglichkeiten, darüber nachzudenken, wie wir ein medizinisches Problem angehen können, bei dem ein Gen hyperaktiv ist“, sagte Young. Die DSPD-Entdeckung liefert die Identität einer Mutation.