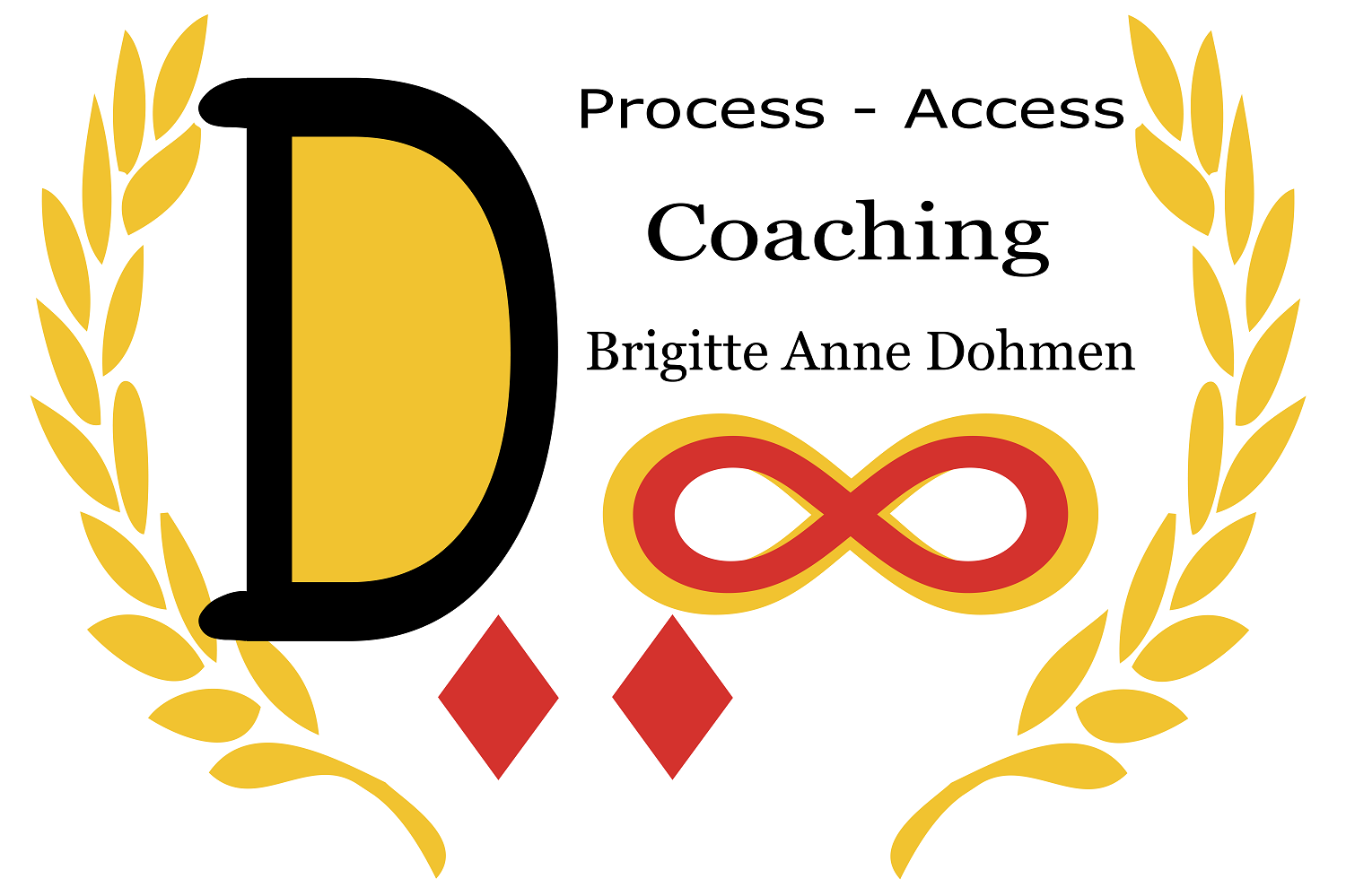Wolkenbildung (wenn Luft viel Wasserdampf (Gas) enthält.
Wind ist die horizontale Bewegung von Luft, die Energie transportiert, die von der Erdoberfläche als fühlbare und latente Wärme übertragen wird. Fühlbare Wärme wird durch Leitung und Konvektion übertragen. Leitung überträgt Energie innerhalb einer Substanz und Konvektion überträgt Energie durch die vertikale Bewegung der erhitzten Substanz. Latente Wärme ist die Übertragung von Energie durch Umwandlung der Substanz selbst. Wie Sie sich erinnern, kann Wasser als Flüssigkeit, Gas oder Feststoff vorliegen. Die Umwandlung von Flüssigkeit in Gas nennt man Verdunstung; der umgekehrte Prozess, von Gas in Flüssigkeit, heißt Kondensation; von Flüssigkeit in Feststoff wird als Verfestigung (Gefrieren) bezeichnet und von Feststoff in Flüssigkeit als Fusion (Schmelzen). Wasser kann auch direkt von Feststoff in Gas umgewandelt werden (Sublimation) oder umgekehrt, durch einen Prozess namens Deposition. Wir werden diese verschiedenen Prozesse bei der Wolkenbildung sehen. Wolken entstehen, wenn Luft so viel Wasserdampf (Gas) enthält, wie sie aufnehmen kann. Dieser Sättigungspunkt wird als Sättigungspunkt bezeichnet und kann auf zwei Arten erreicht werden. Erstens sammelt sich Feuchtigkeit, bis die maximale Aufnahmekapazität des Luftvolumens erreicht ist. Zweitens sinkt die Temperatur der feuchten Luft, wodurch die Feuchtigkeitsaufnahme sinkt. Sättigung wird daher durch Verdunstung bzw. Kondensation erreicht. Bei Sättigung wird Feuchtigkeit in Form von sichtbaren Wassertröpfchen in Form von Nebel und Wolken sichtbar.
Es ist zu beachten, dass Kondensation allein keinen Niederschlag (Regen, Schnee, Graupel, Hagel) verursacht. Die Feuchtigkeit in den Wolken muss schwer genug werden, um der Schwerkraft zu unterliegen und zur Erdoberfläche zurückzukehren. Dies geschieht durch zwei Prozesse. In kalten Wolken existieren Eiskristalle und Wassertropfen nebeneinander. Aufgrund eines Ungleichgewichts des Wasserdampfdrucks gehen die Wassertropfen auf die Eiskristalle über. Die Kristalle werden schließlich schwer genug, um zu Boden zu fallen. Im zweiten Prozess kollidieren Wassertropfen in warmen Wolken und verändern ihre elektrische Ladung. Tropfen mit unterschiedlicher Ladung ziehen sich an und verschmelzen, wodurch sie wachsen, bis sie genug Gewicht haben, um zu fallen.
Es gibt keinen Unterschied zwischen Nebel und Wolken außer der Höhe. Nebel wird als sichtbare Feuchtigkeit definiert, die in einer Höhe von weniger als 15 Metern beginnt. Beginnt die sichtbare Feuchtigkeit in 15 Metern Höhe oder darüber, spricht man von einer Wolke. Zwei gängige Nebelarten sind Strahlungsnebel und Advektionsnebel. Strahlungsnebel bildet sich während der Nacht, wenn die Erdoberfläche abkühlt und die Luft unmittelbar darüber sich wiederum durch Leitung abkühlt. Ist die Luft feucht genug, erreicht sie durch die Abkühlung ihren Sättigungspunkt und es bilden sich sichtbare Wassertropfen. Wir nennen diese Art Nebel oft Bodennebel, weil er so nah an der Oberfläche liegt. Advektionsnebel bildet sich, wenn warme, feuchte Luft über eine kältere Oberfläche zieht (Advektion bedeutet horizontale Bewegung). Ein perfektes Beispiel sind die Westküsten der Kontinente. Vorherrschende Westwinde bewegen feuchte Luft von einem warmen Meeresgebiet über die kälteren Gewässer vor der Küste. Nebel bildet sich und wird vom Westwind über das Land getragen.
Wolken und Regen machen
Obwohl die Entstehung von Wolken und Niederschlag in allen Einzelheiten recht komplex sein kann, können wir den Prozess zu einem einfachen Rezept vereinfachen, das für die überwiegende Mehrheit der Situationen geeignet ist. Zunächst benötigen wir zwei Grundzutaten: Wasser und Staub.Auf dem Planeten Erde bestehen natürliche Wolken hauptsächlich aus flüssigem oder festem Wasser. (Auf anderen Planeten können sich Wolken aus anderen Verbindungen bilden, wie beispielsweise die Schwefelsäurewolken auf der Venus.) Daher beginnen wir unser Rezept mit der Sammlung einer ausreichenden Menge Wasserdampf, den wir bald in den flüssigen oder festen Zustand überführen. Der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre variiert von nahezu null bis etwa 4 Prozent, abhängig von der Feuchtigkeit der darunterliegenden Oberfläche und der Lufttemperatur.Als nächstes brauchen wir etwas Staub. Weder große Mengen noch große Partikel und nicht jeder Staub sind geeignet. Ohne „schmutzige Luft“ gäbe es wahrscheinlich gar keine Wolken oder nur hochgelegene Eiswolken. Selbst die „sauberste“ Luft der Erde enthält etwa 1000 Staubpartikel pro Kubikmeter Luft. Staub wird für Kondensationskerne benötigt, an denen Wasserdampf kondensieren oder sich als Flüssigkeit oder Feststoff ablagern kann. Bestimmte Arten und Formen von Staub- und Salzpartikeln, wie Meersalz und Ton, bilden die besten Kondensationskerne.Wenn sich in einem Luftpaket die richtigen Mengen an Wasserdampf und Staub befinden, wird die Luftpaketmasse im nächsten Schritt auf eine Temperatur abgekühlt, bei der sich Wolkentröpfchen oder Eiskristalle bilden können. Und voilà, wir haben Wolken.
Dieses einfache Rezept ähnelt stark dem Kochen von Hühnchen: Man nimmt ein Hühnchen mit Gewürzen, erhitzt es und hat nach einiger Zeit ein gegart es Hühnchen. Doch so wie es viele Möglichkeiten gibt, Hühnchen zuzubereiten, gibt es auch viele verschiedene Möglichkeiten, Wolken zu bilden.
Erweitern wir nun unser Rezept um Niederschlag. Professor John Day, der Wolkenmann, hat das einfache Wolkenrezept übernommen, einige Details hinzugefügt und es so lange weiterentwickelt, bis auch Niederschlag entsteht. Er nennt dies die Niederschlagsleiter. Wie bei unserem einfachen Rezept beginnt er den Prozess mit den Grundzutaten schmutziger Luft und Wasserdampf. In den Stufen 3 bis 8 führt er die Zutaten durch mehrere Prozesse, bis eine Wolke entsteht. Aufstieg und Ausdehnung sind zwei der Hauptprozesse, die zur Abkühlung einer Luftmasse führen, in der sich Wolken bilden. Wir denken bei bewegter Luft meist an horizontal strömenden Wind. Vertikale Luftbewegungen sind jedoch für Wetterprozesse, insbesondere für Wolken und Niederschlag, von großer Bedeutung. Aufsteigende Luftströmungen führen uns die Niederschlagsleiter hinauf. (Bei absteigenden Strömungen steigen wir die Leiter hinunter, wobei sich die Prozesse umkehren, bis schließlich Wasserdampf und Staub in einer Luftmasse zurückbleiben.) An oder nahe der Erdoberfläche finden vier Hauptprozesse statt, die zu aufsteigender Luft führen können: Konvergenz, Konvektion, Frontalauftrieb und physikalischer Auftrieb. Konvergenz tritt auf, wenn sich mehrere Luftströmungen in der horizontalen Strömung aufeinander zu bewegen und sich in einem gemeinsamen Raum treffen. Wenn sie zusammenlaufen, gibt es nur eine Richtung: nach oben. Ein Tiefdruckgebiet an der Oberfläche ist ein Beispiel für einen Konvergenzbereich, und die Luft in seinem Zentrum muss daher aufsteigen.Konvektion entsteht, wenn Luft von unten durch Sonnenlicht oder durch Kontakt mit einer wärmeren Land- oder Wasseroberfläche erwärmt wird, bis ihre Dichte geringer wird als die darüber liegende Luft. Die erwärmte Luft steigt auf, bis sie wieder auf die Temperatur der Umgebungsluft abgekühlt ist. Frontallifting entsteht, wenn eine wärmere Luftmasse auf eine kältere trifft. Da warme Luft weniger dicht ist als kalte, steigt eine warme Luftmasse, die sich einer kalten nähert, über die kalte Luft auf. Dadurch entsteht eine Warmfront. Nähert sich eine kalte Luftmasse einer warmen, verkeilt sie sich unter der wärmeren Luft und hebt diese über den Boden. Dadurch entsteht eine Kaltfront. In beiden Fällen befindet sich an der Frontgrenze aufsteigende Luft. Physikalische Hebung, auch orografische Hebung genannt, tritt auf, wenn horizontale Winde gezwungen sind, aufzusteigen, um topografische Barrieren wie Hügel und Berge zu überwinden. Unabhängig vom Prozess, der ein Luftpaket aufsteigen lässt, muss das aufsteigende Luftpaket seinen Druck ändern, um im Gleichgewicht mit der Umgebungsluft zu sein. Da der atmosphärische Druck mit der Höhe abnimmt, muss auch der Druck des aufsteigenden Luftpakets abnehmen. Beim Aufsteigen dehnt sich Luft aus. Und während sie sich ausdehnt, kühlt sie ab. Und je höher das Paket steigt, desto kühler wird es. Nachdem wir mit der Abkühlung der Luftmasse begonnen haben, ist die Wolkenbildung fast abgeschlossen. Wir müssen die Masse weiter abkühlen, bis Kondensation auftritt. Die nächsten Sprossen der Niederschlagsleiter beschreiben die Prozesse bis zur Kondensation von flüssigem Wasser. Wenn die Luft abkühlt, steigt ihre relative Luftfeuchtigkeit ein Prozess, den Day als Befeuchtung bezeichnet Obwohl sich der Wasserdampfgehalt der Luft noch nicht verändert hat, ist die Sättigungsschwelle der Luftmasse mit dem Abkühlen gesunken. Durch die Senkung der Sättigungsschwelle steigt die relative Luftfeuchtigkeit. Kühlung ist die wichtigste Methode zur Erhöhung der relativen Luftfeuchtigkeit, aber nicht die einzige. Eine andere Möglichkeit ist die Zugabe von mehr Wasserdampf durch Verdunstung oder Vermischung mit einer feuchteren Luftmasse. Soll eine Wolke entstehen, kann Befeuchtung die Luft im Inneren des Partikels bis zur Sättigung bringen. Bei Sättigung beträgt die relative Luftfeuchtigkeit 100 Prozent. Normalerweise ist etwas mehr Befeuchtung erforderlich, um die relative Luftfeuchtigkeit auf über 100 Prozent zu bringen (Übersättigung), bevor sich eine Wolke bildet. Bei übersättigter Luft sucht der Wasserdampf nach Möglichkeiten, zu kondensieren. Bei idealer Staubmenge und Zusammensetzung kann die Kondensation bereits bei einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 100 Prozent beginnen. Bei sehr sauberer Luft kann eine hohe Übersättigung erforderlich sein, um Wolkentröpfchen zu bilden. Typischerweise beginnt die Kondensation jedoch bereits bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von wenigen Zehntel Prozent über der Sättigung.
Die Kondensation von Wasser an Kondensationskernen (oder die Ablagerung von Wasserdampf als Eis an gefrierenden Kernen) beginnt in einer bestimmten Höhe, der sogenannten Wolkenuntergrenze oder Höhenkondensationsgrenze. Wassermoleküle lagern sich an den Partikeln an und bilden Wolkentröpfchen mit einem Radius von etwa 20 Mikrometern (0,02 mm) oder weniger. Das Tröpfchenvolumen ist in der Regel millionenfach größer als das typischer Kondensationskerne. Wolken bestehen aus einer großen Anzahl von Tröpfchen, Eiskristallen oder beidem. Aufgrund ihrer geringen Größe und des relativ hohen Luftwiderstands können sie lange in der Luft schweben, insbesondere in aufsteigenden Luftströmungen.
Ein durchschnittliches Tröpfchen hat in ruhender Luft eine Fallgeschwindigkeit von 1,3 cm pro Sekunde. Zum Vergleich: Ein durchschnittliches Tröpfchen, das von einer typischen niedrigen Wolkenuntergrenze von 500 Metern/1.650 Fuß fällt, würde mehr als 10 Stunden benötigen, um den Boden zu erreichen.Wir wissen heute, dass Zirruswolken in ihren verschiedenen Formen aus Eiskristallen bestehen und dass die oberen Schichten hoher Cumuluswolken sogar im Sommer Eis enthalten können. Obwohl Wolken in ihren vielfältigen Formen und Erscheinungsformen (der Wolkenatlas) eine Quelle großen Interesses sind, werden wir sie jetzt verlassen und die Niederschlagsleiter hinauf zur obersten Sprosse gehen: Niederschlag. Bildung von Niederschlag Leichter Regen.
Wir wissen, dass nicht alle Wolken Regen produzieren, der auf den Boden trifft. Manche Wolken produzieren Regen oder Schnee, der verdunstet, bevor er den Boden erreicht, und die meisten Wolken produzieren überhaupt keinen Niederschlag. Wenn Regen fällt, wissen wir aus Messungen, dass die Tropfen größer als einen Millimeter sind. Ein Regentropfen mit 2 mm Durchmesser enthält das Wasseräquivalent von einer Million Wolkentröpfchen (0,02 mm Durchmesser). Damit also Niederschlag aus einer Wolke entsteht, müssen innerhalb der Wolke zusätzliche Prozesse stattfinden, die aus Wolkentröpfchen Regentropfen bilden.
Die nächste Stufe der Niederschlagsleiter ist der Auftrieb oder die Bewölkung. Dies bedeutet, dass wir den Wassergehalt der Wolken erhöhen müssen, bevor wir mit Niederschlag rechnen können. Dies erfordert eine Fortsetzung des Auftriebs. Unterstützt wird dies durch die Eigenschaft von Wasser, beim Übergang vom gasförmigen in den flüssigen und festen Zustand Wärme abzugeben: die Kondensations bzw. Ablagerungswärme. (Wenn der Dampf vor dem Gefrieren zunächst flüssig wird, wird zusätzlich die Kondensationswärme und anschließend die Gefrierwärme freigesetzt.) Diese zusätzliche Wärmeabgabe erwärmt das Luftpaket. Dadurch erhöht sich sein Auftrieb gegenüber der Umgebungsluft, was zu seinem weiteren Aufstieg beiträgt. Der weitere Aufstieg dieser Pakete lässt sich in Cumuluswolken beobachten, die ein starkes vertikales Wachstum erreichen. In der Wolke müssen die Tröpfchen so groß werden, dass sie als Regen (Schnee) zu Boden fallen können, ohne zu verdunsten. Wolkentröpfchen können auf drei Arten größer werden. Die erste Möglichkeit besteht in der fortgesetzten Kondensation von Wasserdampf zu Wolkentröpfchen, wodurch deren Volumen/Größe zunimmt, bis sie zu Tröpfchen werden. Während die erste Kondensation von Wasser an Kondensationskernen zur Bildung von Wolkentröpfchen relativ schnell erfolgt, verläuft das weitere Wachstum der Wolkentröpfchen auf diese Weise sehr langsam.Zweitens ist das Wachstum durch Kollision und Verschmelzung von Wolkentropfen (und anschließend die Kollision von Regentropfen mit Wolkentropfen und anderen Tropfen) ein viel schnellerer Prozess. Turbulente Strömungen in den Wolken sorgen für die ersten Kollisionen zwischen den Tropfen. Diese Kombination bildet einen größeren Tropfen, der weiter mit anderen Tropfen kollidieren kann und so schnell an Größe zunimmt.Mit zunehmendem Tropfenwachstum erhöht sich auch ihre Fallgeschwindigkeit, sodass sie mit langsamer fallenden Tropfen kollidieren können. Ein Tropfen mit einem Radius von 0,5 mm und einer Fallgeschwindigkeit von 4 m/s kann einen Tropfen mit einem Durchmesser von 0,05 mm (50 Mikrometer) und einer Fallgeschwindigkeit von 0,27 m/s schnell überholen. Bei zu großen Tropfen ist die Sammeleffizienz für kleinste Tropfen und Tröpfchen jedoch geringer als bei Tropfen ähnlicher Größe. Kleinere Tropfen können von viel größeren Tropfen abprallen oder um sie herumfließen und verschmelzen daher nicht. Ein Tropfen mit einem um etwa 60 % kleineren Durchmesser wird am ehesten von einem großen Tropfen aufgefangen.Wolken mit starken Aufwindgebieten weisen das beste Tropfenwachstum auf, da die Tropfen und Tröpfchen länger in der Wolke verbleiben und somit viel mehr Kollisionsmöglichkeiten haben. Es mag seltsam erscheinen, aber die besten Bedingungen für Tropfenwachstum herrschen, wenn Eiskristalle in einer Wolke vorhanden sind. In Form kleiner Tröpfchen muss flüssiges Wasser deutlich unter 0 °C (32 °F) abgekühlt werden, bevor es gefriert. Unter optimalen Bedingungen kann ein reiner Tropfen sogar -40 °C erreichen, bevor er gefriert. Daher gibt es innerhalb einer Wolke Bereiche, in denen Eiskristalle und Wassertropfen nebeneinander existieren.Wenn Eiskristalle und unterkühlte Tropfen nahe beieinander liegen, wandern Wassermoleküle vom Tropfen zum Kristall. Dadurch vergrößert sich der Eiskristall auf Kosten des Tropfens. Wenn die Kristalle bei Temperaturen um -10 °C wachsen, beginnen sie, Arme und Äste zu entwickeln den typischen Schneekristall. Solche Kristalle wachsen nicht nur effizient auf Kosten der Wassertropfen, sondern haften auch leicht aneinander und bilden große Aggregate, die wir Schneeflocken nennen. Schliesslich haben die Tropfen eine Größe erreicht, die es ihnen ermöglicht, in angemessener Zeit auf die Oberfläche zu fallen, ohne zu verdunsten. Damit haben wir die höchste Stufe des Niederschlags erreicht. (Weitere Informationen zu Regentropfen finden Sie hier.) Hier einige typische Tropfendurchmesser für verschiedene Regenarten, wobei Wolkentropfen als Referenzgröße dienen. Die meisten Regenfälle liegen im Bereich von 0,2 bis 5 mm (0,008 bis 0,20 Zoll). Natürlich fällt nicht der gesamte Niederschlag als Regen. Ein Großteil der weltweiten Niederschläge fällt als Schnee oder in einer anderen festen Wasserform. Außerhalb der Tropen ist es sogar wahrscheinlich, dass ein Großteil des Niederschlags zunächst in fester Form vorliegt und erst dann zu flüssigem Regen wird, wenn er beim Fallen durch Luft bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt schmilzt. Die meisten Menschen bezeichnen fast jede gefrorene Niederschlagsform, abgesehen von Hagel oder Eiskörnern, als Schneeflocke. Meteorologen sind da jedoch etwas pedantischer. Technisch gesehen bezeichnet der Begriff Schneeflocke eine Ansammlung einzelner Schneekristalle, die während des Falls zusammengestoßen sind und zusammenbleiben. Schneeflocken fallen typischerweise, wenn die Lufttemperaturen in Erdnähe nicht weit vom Gefrierpunkt entfernt sind. Bei diesen Temperaturen haften Schneekristalle besser aneinander. Bei sehr kalten Temperaturen sind Schneeflocken selten, und wir sehen während eines Schneefalls meist Schneekristalle. Schneekristalle sind typischerweise 0,5 bis 5 Millimeter (0,02 bis 0,20 Zoll) groß, während Schneeflocken etwa 10 mm (0,4 Zoll) groß sind und bis zu 200 bis 400 mm (0,79 bis 1,57 Zoll) groß werden können. Weitere häufige Formen von festem Niederschlag sind Hagel, Graupel oder Eiskörner, Graupel oder weicher Hagel oder Schneekörner sowie eine besondere Form: gefrierender Regen, auch als Glasur oder Raureif bekannt. Letzterer fällt flüssig, gefriert aber bei Kontakt mit einem Gegenstand. Bildet sich klares Eis, spricht man von Glasur. Ist das Eis milchig, spricht man von Raureif.Hagel ist ein Phänomen schwerer Gewitter. Zur Bildung von Hagelkörnern sind starke Aufwinde erforderlich, wobei die Hagelkörner viele Male durch mit Tropfen und Eiskristallen beladene Luft geführt werden.
Flächenmäßige ) Abkühlung der Luft bis zum Taupunkt) Hebena Konvektion Heizung von unten) Advektion über wärmere Oberfläche) Sonneneinstrahlung) Advektion warmer Luft in den untersten Schichten Kühlung von oben, Strahlung von der Oberseite der Wolkendecke Advektion kalter Luft in der Höhe Mechanisches Anheben entlang einer Oberfläche1) Orographisch Überfahren einer potentiellen Temperaturoberfläche Aufwärtsgleiten entlang einer Frontflächec) Konvergenz Tiefdruckzentrum des Trogs Windscherung (Geschwindigkeit und/oder Richtungskonvergenz)3) Breitengradänderung (nach Norden fließende Strömung) Zunahme der Wirbelstärke (südwärts gerichtete Strömung)2) Strahlung (Nebel) Leitung von kühleren Oberflächen (Nebel) Vermischung mit kühlerer Luftmasse. Zunahme der Feuchtigkeit (Erwärmung des Taupunkts auf die Temperatur) Mischen) Durch Konvektion verursacht. Durch starken Wind verursacht. Kontakt mit feuchter Oberfläche. LP Verdunstung durch fallenden Niederschlag) Advektion, Veränderungen während der Advektion wie oben für die verschiedenen Betriebsprozesse angegeben. Der vertikale Aufstieg der Luft verringert daher ihre Fähigkeit, Wasserdampf zu speichern, so dass Kondensation auftritt. Die Höhe, in der der Taupunkt erreicht wird und sich Wolken bilden, wird als Kondensationsniveau bezeichnet. Es gibt fünf Faktoren, die dazu führen können, dass Luft aufsteigt und abkühlt: Oberflächenerwärmung . Der Boden wird durch die Sonne erwärmt, die wiederum die Luft in Kontakt mit ihm erhitzt und sie aufsteigen lässt. Diese aufsteigenden Säulen werden oft als Thermik bezeichnet. Topografie. Luft wird gezwungen, über eine Barriere aus Bergen oder Hügeln aufzusteigen. Dies wird als orografische Hebung bezeichnet. Frontal. Eine Masse warmer Luft steigt über eine Masse kalter, dichter Luft auf. Diese Grenze wird als „Front“ bezeichnet. Konvergenz Luftströme, die aus verschiedenen Richtungen strömen, werden an ihrer Schnittstelle zum Aufsteigen gezwungen. Turbulenz. Eine plötzliche Änderung der Windgeschwindigkeit mit der Höhe, die turbulente Wirbel in der Luft erzeugt. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass Wasserdampf kondensieren muss. In der Luft schweben Millionen winziger Salz-, Staub- und Rauchpartikel, sogenannte Kondensationskerne. Diese ermöglichen Kondensation, wenn die Luft gerade gesättigt ist. Der vertikale Aufstieg der Luft verringert daher ihre Fähigkeit, Wasserdampf zu speichern, sodass Kondensation auftritt. Die Höhe, in der der Taupunkt erreicht wird und sich Wolken bilden, wird als Kondensationsniveau bezeichnet. Es gibt fünf Faktoren, die dazu führen können, dass Luft aufsteigt und abkühlt:
1.Oberflächenerwärmung. Der Boden wird durch die Sonne erwärmt, die wiederum die Luft in Kontakt mit ihm erhitzt und sie aufsteigen lässt. Diese aufsteigenden Säulen werden oft als Thermik bezeichnet.
2.Topografie Luft wird gezwungen, über eine Barriere aus Bergen oder Hügeln aufzusteigen. Dies wird als orografische Hebung bezeichnet.
3.Frontal:Eine Masse warmer Luft steigt über eine Masse kalter, dichter Luft auf. Diese Grenze wird als Front“ bezeichnet.
4.Konvergenz: Luftsröme,die aus verschiedenen Richtungen strömen, werden an ihrer Schnittstelle zum Aufsteigen gezwungen.
5.Turbulenz Eine plötzliche Änderung der Windgeschwindigkeit mit der Höhe, die turbulente Wirbel in der Luft erzeugt.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass Wasserdampf kondensieren muss. In der Luft schweben Millionen winziger Salz-, Staub- und Rauchpartikel, sogenannte Kondensationskerne. Diese ermöglichen Kondensation, wenn die Luft gerade gesättigt ist.
Was beeinflusst die Farbe der Wolken?
Sowohl Himmels- als auch Wolkenlicht ist gestreutes Sonnenlicht. Im Himmel übernehmen die Luftmoleküle (Stickstoff und Sauerstoff) die Streuung. Die Moleküle sind jedoch so klein, dass der blaue Teil des Spektrums stärker gestreut wird als andere Farben. Die Wassertropfen in der Wolke sind viel größer und diese größeren Partikel streuen alle Farben des Spektrums etwa im gleichen Maße, sodass das weiße Licht der Sonne immer noch weiß aus den Wolken austritt. Manchmal haben Wolken einen gelblichen oder bräunlichen Farbton das ist ein Zeichen für Luftverschmutzung.Warum hören Wolken auf, nach oben zu wachsen? Bei der Kondensation wird latente Wärme freigesetzt. Dies ist die „unsichtbare“ Wärme, die ein Wassertropfen speichert, wenn er sich von flüssig zu verdampfen beginnt. Durch die anschließende Formveränderung wird erneut genügend latente Wärme freigesetzt, um das feuchte Luftpaket wärmer als die umgebende Luft zu machen. Dadurch kann das Luftpaket aufsteigen, bis der gesamte „überschüssige“ Wasserdampf kondensiert und die gesamte latente Wärme freigesetzt ist. Der Hauptgrund für das Aufsteigen von Wolken ist daher das Ende der Freisetzung latenter Wärme durch den Kondensationsprozess. Zwei weitere Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle: Schnellere Höhenwinde können die Wolkenoberseiten ablösen, während sehr hohe Wolken die Tropopause überqueren und in die Stratosphäre gelangen können, wo die Temperaturen mit der Höhe steigen, anstatt zu fallen. Diese thermische Veränderung verhindert weitere Kondensation.
Warum gibt es an manchen Tagen keine Wolken?
Selbst bei sehr warmem und sonnigem Wetter kann es sein, dass der Himmel wolkenlos ist und klar und blau. Der Grund dafür liegt meist in der Drucklage, wenn das Gebiet einem Hochdruckgebiet oder Antizyklon ausgesetzt ist. Die Luft sinkt langsam ab, anstatt aufzusteigen und abzukühlen. Wenn die Luft in den unteren Teil der Atmosphäre sinkt, steigt der Druck, die Luft wird komprimiert und erwärmt sich, so dass keine Kondensation stattfindet. Kurz gesagt: Unter diesen Druckbedingungen gibt es keine Mechanismen für die Wolkenbildung.
Arten von Wolken
Im Jahr 1803 schlug der Apotheker und Hobbymeteorologe Luke Howard ein System vor, das später zur Grundlage der heutigen internationalen Klassifikation wurde. Howard wurde auch als „Vater der britischen Meteorologie“ bezeichnet. Seine Pionierarbeit basierte auf seiner Neugier auf die leuchtenden Sonnenuntergänge im späten 18. Jahrhundert nach einer Reihe heftiger Vulkanausbrüche. Diese hatten Staub hoch in die Atmosphäre geschleudert, wodurch die Menge an Kondensationskernen zunahm und spektakuläre Wolkenformationen und Sonnenuntergänge erzeugt wurden.
Howard erkannte vier Wolkentypen und gab ihnen die folgenden lateinischen Namen:
Cumulus – aufgehäuft oder in einem Stapel
Stratus – in einer Schicht oder Lage
Cirrus – fadenförmig, haarig oder gekräuselt
Nimbus – ein Regenbringer
Wenn wir ein weiteres lateinisches Wort, „altum“, mit einbeziehen, das Höhe bedeutet, sind die Namen der zehn wichtigsten Wolkenarten alle von diesen fünf Wörtern abgeleitet und basieren auf ihrem Aussehen vom Boden aus und ihren visuellen Eigenschaften.
Die Wolkentypen werden entsprechend ihrer Basishöhe über dem Meeresspiegel in drei Gruppen eingeteilt. Beachten Sie, dass Wolken mittlerer Höhe mit dem Wort „alto“ und Wolken hoher Höhe mit dem Wort „cirro“ beginnen. Alle Höhenangaben beziehen sich auf ungefähre Werte über dem Meeresspiegel in mittleren Breiten. Bei Beobachtungen von einem Hügel oder Berg aus ist die Basishöhe entsprechend geringer.
Niedrige Wolken Oberfläche – 7.000 Fuß
Mittlere Wolken 7.000 – 17.000 Fuß
Hohe Wolken 17.000 – 35.000 Fuß
TIEFE WOLKEN
Cumulus (Cu)
Basishöhe: 360–1834 m
Farbe: Weiß an den sonnenbeschienenen Teilen, aber mit dunklerer Unterseite.
Form: Diese Wolke erscheint in Form losgelöster Haufen. Flache Cumuluswolken können recht zerlumpt erscheinen, besonders bei starkem Wind, aber gut geformte Wolken haben abgeflachte Basen und scharfe Konturen. Große Cumuluswolken haben eine charakteristische „Blumenkohl“-Form.
Weitere Merkmale: Gut entwickelte Cumuluswolken können Schauer erzeugen.
Cumulonimbus (Cb)
Basishöhe: 300–1524 m
Farbe: Weiße Oberseite mit dunkler, bedrohlicher Unterseite.
Form: Eine Cumulusartige Wolke mit beträchtlicher vertikaler Ausdehnung. Wenn die Spitze eines Cumulus große Höhen erreicht, verwandeln sich die Wassertropfen in Eiskristalle und er verliert seine klare, scharfe Kontur. In diesem Stadium hat sich die Wolke zu einem Cumulonimbus entwickelt. Oft breitet sich die faserige Wolkenspitze zu einer charakteristischen Keil- oder Ambossform aus.
Weitere Merkmale: Begleitet von heftigen Regenschauern, ggf. mit Hagel und Donner. Konventionell wird Cb bei Hagel oder Donner gemeldet, auch wenn der Beobachter die Wolke nicht sofort als Cb erkennt (sie kann in Schichten anderer Wolkentypen eingebettet sein).
Stratus (St)
Basishöhe: Oberfläche – 457 m.
Farbe: Normalerweise grau.
Form: Kann als Schicht mit relativ gleichmäßiger Basis oder in unregelmäßigen Flecken erscheinen, insbesondere bei Niederschlag aus einer darüber liegenden Wolkenschicht. Nebel hebt sich oft aufgrund von stärkerem Wind oder steigender Temperatur zu einer Stratusschicht auf. Wenn die Sonne den Boden erwärmt, kann die Basis der Stratuswolke aufsteigen und sich zu einer flachen Cumuluswolke auflösen, da ihre Ränder eine deutlichere Form annehmen.
Weitere Merkmale: Bei dünner Schicht ist die Sonnen- oder Mondscheibe sichtbar (vorausgesetzt, es befinden sich keine anderen Wolken darüber). Bei dicker Schicht kann Nieselregen oder Schneekörner entstehen.
Stratocumulus (Sc)
Basishöhe: 360–2130 m.
Farbe: Grau oder weiß, meist mit Schattierung.
Form: Entweder Flecken oder eine Schicht abgerundeter Elemente, kann aber auch als wellenförmige Schicht erscheinen. Vom Boden aus betrachtet, haben einzelne Elemente in einer Höhe von über 30 Grad (der Breite von drei Fingern auf Armlänge) eine scheinbare Breite von mehr als 5 Grad.
Weitere Merkmale: Kann leichten Regen oder Schnee erzeugen. Manchmal entstehen die Wolken durch die Ausbreitung von Cumuluswolken und erzeugen einen leichten Schauer
MITTLERE WOLKEN
Altocumulus (Ac)
Basishöhe: 7.000–17.000 Fuß
Farbe: Grau oder weiß, im Allgemeinen mit gewissen Schattierungen.
Form: Mehrere unterschiedliche Typen, am häufigsten sind Flecken oder Platten aus abgerundeten Elementen, sie können aber auch als Schicht ohne viel Form erscheinen. Vom Boden aus betrachtet haben einzelne Elemente in einer Höhe von über 30 Grad eine scheinbare Breite von 1 bis 5 Grad (die Breite von 1 bis 3 Fingern auf Armlänge). Auch wenn die Elemente kleiner erscheinen, wird die Wolke immer noch als Altocumulus klassifiziert, wenn sie Schattierungen aufweist.
Weitere Merkmale: Gelegentlich kann leichter Regen oder Schnee, vielleicht in Form eines Schauers, den Boden erreichen. In seltenen Fällen kann aus einem Ac-Typ, dem sogenannten Altocumulus castellanus, ein Gewitter entstehen. Der Name kommt daher, dass die Wolkenoberseiten in der Draufsicht wie eine Reihe von Türmen und Türmen entlang einer Burgmauer aussehen.
Altostratus (As)
Basishöhe: 2440–4260 m
Farbe: Gräulich oder bläulich.
Form: Eine gleichmäßig erscheinende Schicht, die den Himmel ganz oder teilweise bedeckt.
Weitere Merkmale: Manchmal so dünn, dass Sonne oder Mond wie durch Mattglas undeutlich zu erkennen sind. Objekte auf dem Boden werfen keine Schatten. Kann im Allgemeinen leichten Regen oder Schnee bringen, gelegentlich Eiskörner, wenn die Wolkenbasis nicht höher als etwa 3.000 m ist.
Nimbostratus (Ns)
Basishöhe: 450–3.000 m
Farbe: Dunkelgrau.
Form: Eine dicke, diffuse Schicht, die den ganzen oder den größten Teil des Himmels bedeckt. Weitere Merkmale: Sonne oder Mond immer verdeckt. Begleitet von mäßigem oder starkem Regen oder Schnee, gelegentlich Eiskörner. Obwohl als mittlere Wolke eingestuft, sinkt ihre Basis häufig bis auf niedrige Wolkenhöhe. Kann teilweise oder sogar ganz durch Stratus verdeckt sein, der sich bei Niederschlag darunter bildet.
HOHE WOLKEN
Cirrus (Ci)
Basishöhe: 17.000–35.000 Fuß
Farbe: Besteht aus Eiskristallen, daher weiß.
Form: Zarte, haarähnliche Fäden, manchmal am Ende hakenförmig; oder in dichteren, verwickelten Flecken; oder gelegentlich in parallelen Bändern, die zum Horizont hin zusammenzulaufen scheinen. Andere Merkmale: Die Überreste des oberen Teils einer Cumulonimbus werden auch als Cirrus klassifiziert.
Cirrocumulus (Cc) Basishöhe: 17.000–35.000 Fuß
Farbe: Besteht aus Eiskristallen, daher weiß.
Form: Flecken oder Schichten aus sehr kleinen Elementen in Form von Körnern oder Wellen oder einer Bienenwabe. Vom Boden aus betrachtet haben einzelne Elemente in einer Höhe von über 30 Grad eine scheinbare Breite von weniger als 1 Grad (nicht breiter als die Breite eines kleinen Fingers auf Armlänge).
Weitere Merkmale: Manchmal ähnelt sein Aussehen in einem regelmäßigen Muster aus „Wellen“ und kleinen Lücken den Schuppen eines Fisches, daher der volkstümliche Name „Makrelenhimmel“. (Dieser Name kann auch hohen Altocumuluswolken zugeschrieben werden.)
Cirrostratus (Cs) Basishöhe: 17.000–35.000 Fuß
Farbe: Besteht aus Eiskristallen, daher weiß.
Form: Ein durchsichtiger Schleier von faseriger oder glatter Erscheinung, der den Himmel ganz oder teilweise bedeckt.
Weitere Merkmale: Dünn genug, damit die Sonne Schatten auf den Boden werfen kann, sofern sie nicht tief am Himmel steht. Erzeugt Halo-Phänomene, am häufigsten der kleine (22 Grad) Halo um Sonne oder Mond – etwas mehr als die Entfernung zwischen der Spitze des Daumens und dem kleinen Finger, die auf Armlänge weit auseinander gespreizt sind.
Kondensstreifen (Kondensstreifen)
Dies sind dünne Kondensstreifen, die durch Wasserdampf entstehen, der aus den Triebwerken von Düsenflugzeugen in großer Höhe ausströmt. Es handelt sich dabei zwar nicht um echte Wolken, sie können jedoch lange am Himmel verbleiben und sich zu Zirruswolken entwickeln
Wolken messen
Die Wolkenmenge wird definiert als der Anteil der Himmelskuppel, der von Wolken bedeckt ist. Die verwendete Skala ist Achtel oder Okta. Beobachter stehen im Freien oder auf einem Dach, um einen guten Blick bzw. ein Panorama des Himmels zu erhalten.
Eine vollständige Wolkenbedeckung wird mit 8 Oktas, eine halbe Bedeckung mit 4 Oktas und ein völlig klarer Himmel mit 0 Oktas angegeben. Bei tiefliegendem Nebel oder Dunst meldet der Beobachter einen verdunkelten Himmel.
Der Reporter wird auch die Stärke jeder Wolkenschicht angeben – 2 Oktas Cumulus und 3 Oktas Cirrus usw.
Da Tiefdruckgebiete häufig über das Vereinigte Königreich ziehen, beträgt die am häufigsten gemeldete Wolkendichte wenig überraschend 8 Oktas. Ein klarer, blauer Himmel, also null Oktas, ist seltener, da sich an heißen, sonnigen Tagen oft dünne Schichten von Cirrostratuswolken oder feine Büschel dünner Cirruswolken in großen Höhen bilden.
Die Entstehung von Niederschlag
Abkühlung, Kondensation und Wolkenbildung bilden den Beginn des Prozesses, der zu Niederschlag führt. Doch nicht alle Wolken produzieren Regentropfen oder Schneeflocken – viele sind so kurzlebig und klein, dass Niederschlagsmechanismen gar nicht erst entstehen können.
Es gibt zwei Theorien, die erklären, wie sich aus winzigen Wolkentröpfchen Niederschlag entwickelt.
- Der Bergeron-Findeisen-Eiskristallmechanismus
- Steigen Luftmassen in der Troposphäre hoch genug, sinkt die Taupunkttemperatur stark ab, und es bilden sich winzige Eiskristalle. Die unterkühlten Wassertropfen gefrieren beim Kontakt mit diesen Eiskernen.
- Die Eiskristalle verbinden sich anschließend zu größeren Flocken, die weitere unterkühlte Tropfen anziehen. Dieser Prozess setzt sich fort, bis die Flocken wieder zum Boden fallen. Beim Durchdringen der wärmeren Luftschichten schmelzen die Eispartikel und bilden Regentropfen. Einige Eiskörner oder Schneeflocken können jedoch durch kalte Fallwinde zu Boden getragen werden.
- Longmuirs Kollisions- und Koaleszenztheorie
- Dies gilt für „warme“ Wolken, also solche ohne große Anzahl von Eiskristallen. Stattdessen enthalten sie Wassertropfen in vielen unterschiedlichen Größen, die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit nach oben getrieben werden, so dass sie mit anderen Tropfen kollidieren und sich mit ihnen verbinden.
- Man geht davon aus, dass die Tröpfchen bei einem Radius von 3 mm durch ihre Bewegung zersplittern und sich auflösen, wodurch ein neuer Vorrat an Wassertröpfchen entstehen.
Künstlicher Regen
In den letzten Jahren fanden vor allem in den USA und der ehemaligen UdSSR Experimente statt, bei denen den Wolken Partikel zugesetzt wurden, die als Kondensations- oder Gefrierkerne wirken. Bei dieser Wolkenimpfung werden Trockeneis, Silberiodid oder andere hygroskopische Substanzen von Flugzeugen aus in die Atmosphäre abgegeben. Diese Experimente fanden größtenteils am Rande landwirtschaftlicher Gebiete statt, wo Regen für das Pflanzenwachstum benötigt wird.